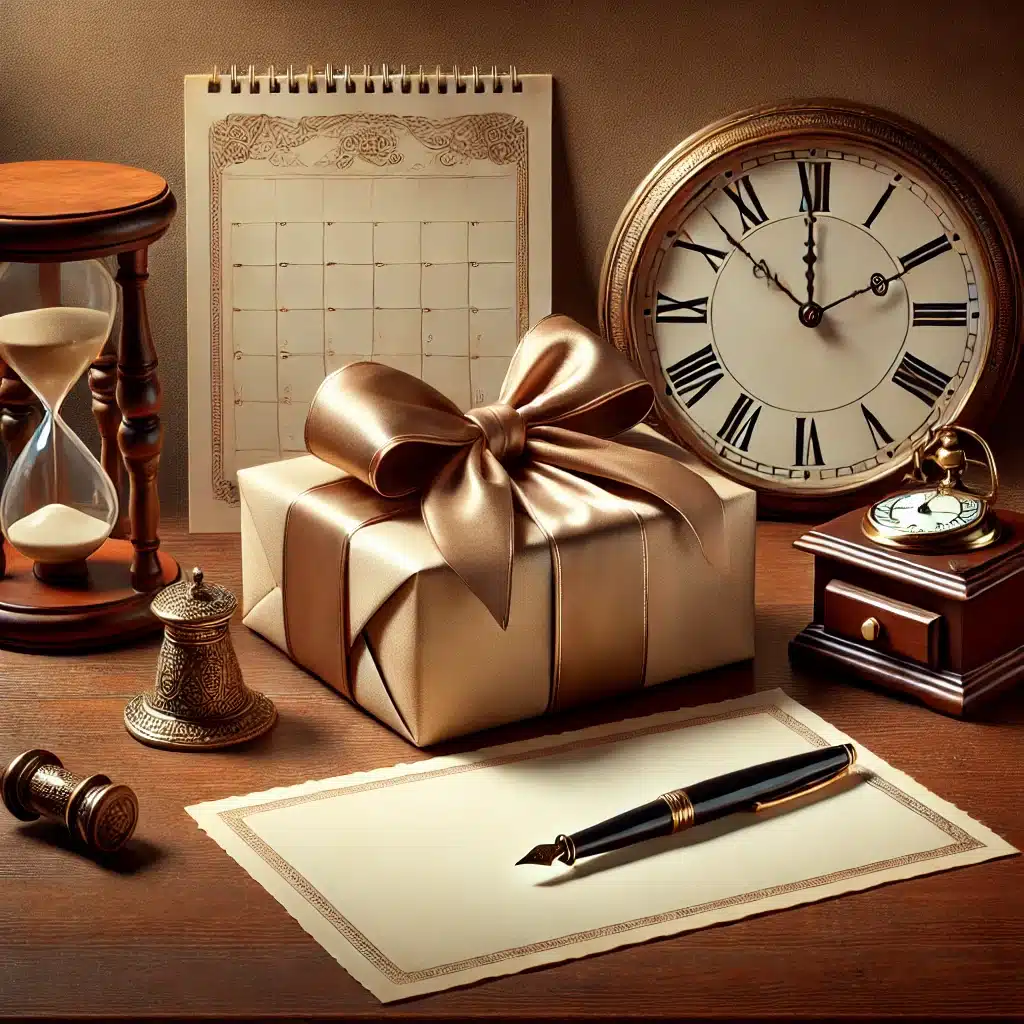Ein Eigengeschenk beschreibt eine Zuwendung, die eine nahestehende Person vom späteren Erblasser bereits zu dessen Lebzeiten erhält. Dabei handelt es sich nicht um eine alltägliche Gabe, sondern um einen Vorgang, der rechtlich bedeutsam sein kann.
Wer ist betroffen?
Adressaten solcher Vermögensübertragungen gehören meist zu den Pflichtteilsberechtigten. Das sind Menschen, denen laut Gesetz ein bestimmter Mindestanteil am Nachlass zusteht – etwa Kinder oder Ehegatten.
Warum ist das relevant?
Wird ein erheblicher Wert vorab verschenkt, kann dies das Erbverhältnis beeinflussen. Um Ungleichbehandlung zu vermeiden, wird geprüft, ob diese Übergabe bei der Aufteilung des Nachlassvermögens berücksichtigt werden muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Übertragung Jahre vor dem Todesfall erfolgt ist – entscheidend ist, dass die beschenkte Person gesetzlich geschützt ist.
Beispielhafte Situation
Eine Mutter überschreibt ihrem Sohn eine Immobilie. Nach ihrem Tod stellt sich heraus, dass fast kein weiteres Eigentum mehr vorhanden ist. Die Tochter, die ebenfalls Anspruch hat, könnte benachteiligt sein. Damit das nicht geschieht, wird der zuvor übertragene Besitz rechnerisch einbezogen.
Rechtliche Einordnung
Das Erbrecht sieht in solchen Fällen die Pflichtteilsergänzung vor. Dieser Mechanismus gleicht eine mögliche Vermögensverschiebung aus und soll sicherstellen, dass niemand durch frühzeitige Zuwendungen leer ausgeht. Besonders relevant ist dies bei Schenkungen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren vor dem Erbfall.
Ziel des Gesetzes
Durch die Einbeziehung früherer Vermögensweitergaben wird eine faire Vermögensverteilung gewährleistet. So bleibt der Schutz der Pflichtteilsberechtigten auch dann bestehen, wenn Teile des Besitzes nicht mehr im Nachlass enthalten sind.